Sprachwandel passiert. No need to worry! Sagen sogar Cambridger Linguisten.
Fahrt in den Feierabend in der Berliner U-Bahn. Der typische Duft aus ungewaschenen Körpern, Hektik und schalem Bier hängt in der Luft. Zwei Mädchen, beide um die 16 Jahre, steigen ein und unterhalten sich lautstark, so dass jeder der keine Kopfhörer auf hat oder mit der Nase im Buch versinkt, ihnen unweigerlich zuhören muss: „Alter, isch geh morgen auf keinen Fall Gym. Null Bock ey. Ischwör!“ – „Ja, dann lass: yolo und so!“ Kiezdeutsch vom Feinsten. Anglizismen wohin man lauscht. Abkürzungen wie „yolo“ für „you only live once“, die sicher die Hälfte der Mitfahrer wohl gar nicht versteht (oder sollte man sagen „checkt“?). Eine Syntax, die Goethe die Haare zu Berge stehen ließe.
Die ganze Konversation der beiden ist eigentlich nur eins: das passende Beispiel, dass Hüter der deutschen Sprache bringen würden, um deren Verfall anzuprangern. Aber ist Sprachwandel wirklich beängstigend, ein Fall fürs Gruselkabinett der Sprachpflege? Müssen Besserwisser oder passender Bessersprecher schlaflose Nächte haben, wenn man ihnen ein Date anträgt statt eine Verabredung? Oder einen „Coffee to go“ bestellt statt einen Kaffee zum Mitnehmen? Am besten noch im Discounter statt im Billigkaufladen.
So unaufhaltsam wie der Sprachwandel sind die Versuche, ihm kritisch und konservierend zu begegnen. Im 17. Jahrhundert verbreitete eine andere Sprache Angst und Schrecken: das böse Französisch, die Sprache des seinerzeit modernsten absolutistischen Staates von Sonnenkönig Ludwig. Linguisten fürchteten damals es könnte die deutsche Sprache überrollen – heute sagt höchstens die Oma aus dem Saarland noch Trottoir statt Bürgersteig, oder der bildungsbeflissene Snob.
Die hessische Zunge des Johann Wolfgang von Goethe
Ignoriert wird von den Sprachkritikern gern auch der Unterschied zwischen gesprochener und geschriebener Sprache. Denn wenn Goethes und Schillers Werke als Inbegriff des „perfekten Deutsch“ herhalten, wird leicht außer acht gelassen, dass Goethes Zunge durch seine hessischen Herkunft gefärbt war, während Schiller schwäbelte.
Wo sich Kulturen vermischen, unterliegt Sprache zwangsläufig Veränderungen. Die Immigration nach Deutschland ist einer der Hauptgründe für den jüngeren und derzeitigen Wandel. Nicht weniger einflussreich für den Sprachprozess sind Umzüge von Muttersprachlern innerhalb des Landes. Wir könnten also unsere Grenzen schließen und uns in unseren Häusern verschanzen, wir können den Medienkonsum einschränken, um der Kreolisierung Deutschlands zu entkommen. Klingt nicht so verlockend? Eben.

Die Gemüter – egal ob am Stammtisch oder an den Universitäten – sollten sich also ruhig mal entspannen, wenn es um die Zukunft der deutschen Sprache geht. Diese Meinung vertreten auch die Linguisten Dr. Sheila Watts und Dr. David Willis der University of Cambridge, die im Forschungszentrum ein Projekt zu grammatischen Veränderungen der Sprache organisieren. Gerade den so groß prophezeiten und fast panisch befürchteten Verlust des Genetivs, etwa in dem Bestseller „Der Dativ ist dem Genetiv sein Tod“ von Bastian Sieg, sehen die beiden nicht: „Forschungen zeigen klar, dass der Genitiv schon seit dem 14. Jahrhundert der am wenigsten verwendete Fall ist. Seitdem hat sich dessen Verwendung zwar noch weiter reduziert – aber eben auch nur ein bisschen. Ganz verschwinden wird er nicht“, so Watts.
Die viel gehegte Befürchtung, dass unsere Artikel auf lange Sicht verschwinden, bejahen die beiden zwar, verstehen das Gemurre von den Deutschen darüber aber nicht, da auch andere Sprachen gut mit weniger Artikeln auskämen. Das kann man wohl nur so nüchtern betrachten, wenn es nicht um die eigene Muttersprache geht. Aber zugegeben, die Diskussion, ob es „der, die oder das Nutella“ heißt, wird wohl kaum jemand vermissen.
„Kommst du Bahnhof oder hast du Auto?“
Im Kiezdeutsch ist der Wegfall der Artikel eines der Kernelemente. Denn diese Art der Sprache, oft auch Kurzdeutsch genannt, kommt besonders in multikulturellen Vierteln vor, die einen hohen Anteil an Sprechern von Muttersprachen mit weniger oder gar keinen Artikeln, wie etwa das Türkische, haben. Da heißt es im Sprachlernprozess dann schnell mal „Ich muss Arzt“, statt „Ich muss zum Arzt“. Dieses Weglassen von Artikeln und Präpositionen wird in etwa 50 Jahren ganz normal sein, prophezeit die deutsche Linguistin Diana Marossek in ihrem Buch „Kommst du Bahnhof oder hast du Auto?“. Diese Meinung teilen die Engländer Watts und Willis nicht. „Viele Menschen die in Kiezdeutsch kommunizieren – vielleicht sogar alle – sind eigentlich bilingual. Sie bewegen sich in dieser Form des Deutschen und einer grammatikalisch korrekteren“, erklärt Willis.
Das zeigt sich auch in der Berliner U-Bahn: Nachdem es mehrere Stationen mit unzähligen sch-Lauten, aber ohne Zum’s, Ins’ oder Beim’s hoch her ging, klingelt das Handy von einem der Mädchen. In perfektem Hochdeutsch erklärt sie ihrer Mutter, dass sie gerade noch mit einer Freundin unterwegs sei und heute etwas später nach Hause komme. Ein abrupter Sprung in die bilinguale Parallelwelt. Es war genauso. Ischwör!
Foto aus der Berliner U-Bahnstation: © Nathalie Capitan / flickr.com
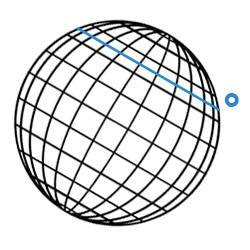

Mietze wo gehse? Konsum. Warte mich. – dies war ein gebräuchlicher Witz über die Sprache des Ruhrpotts. Auch hier hatte sich schon, durch die vor gut 100 Jahren integrierten polnischen Kriegsdeportierten, eine Vereinfachung der deutschen Sprache eingeschlichen. Das Weglassen von Präpositionen und Pronomen war und ist auch heute noch ein Kennzeichen des Ruhrpott-Deutsch.
Ein schöner Artikel zum Sprachwandel. Gruß – Rudolf Jürcke , geb. im Pott